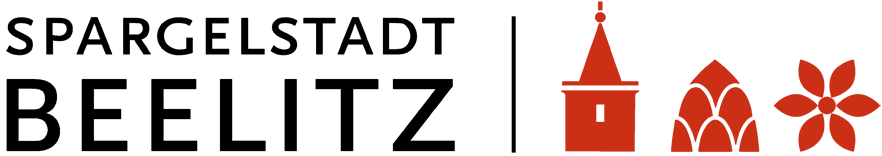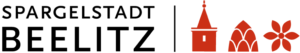Begriffe wie „Energiewende“, „Nachhaltigkeit“, „Prävention“ und „Klimawandel“ tauchen täglich in den Nachrichten auf. Daher können Sie sich hier über viele dieser Themen informieren und weiterführendes Wissen zu einschlägigen Internetseiten unter den Links finden.
Stadtverwaltung Beelitz
Berliner Str. 202, 14547 Beelitz
info@beelitz.de
Tel.: 033204 – 3910
Fax: 033204 – 39135
Unsere Öffnungszeiten
Montag: 9–12 Uhr, 13–15 Uhr
Dienstag: 9–12 Uhr, 13–18 Uhr
Donnerstag: 9–12 Uhr, 13–17 Uhr